Nächster Artikel
Künstliche Intelligenz
Quantencomputing und KI
Die Hoffnung ist groß: Sollten Quantencomputer anfangs »nur« die Simulationen von quantenmechanischen Prozessen verbessern, könnten sie künftig unter anderem dabei helfen, KI-Systeme effizienter zu trainieren. Erste kleine Quantencomputer sind bereits kommerziell erhältlich. Doch welches Potenzial steckt – derzeit – tatsächlich in ihnen?

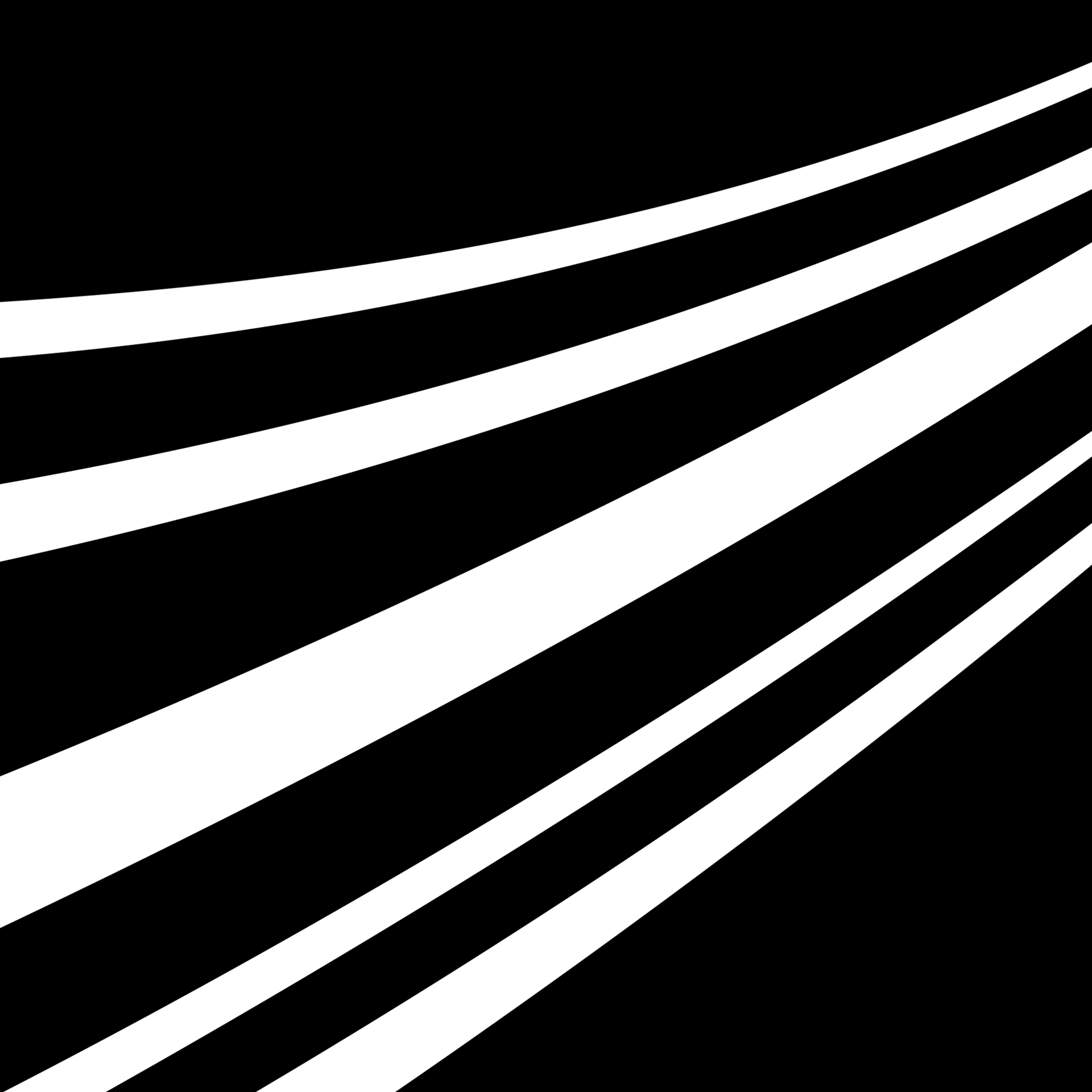

© iStock/Peter Hansen
Klassische Computer können viel. Doch haben auch ihre Fähigkeiten Grenzen: So etwa bei der Simulation von quantenmechanischen Systemen, beispielsweise von Molekülen. Stattdessen sind neuartige Computer gefragt, die die quantenmechanischen Prinzipien direkt in ihren Berechnungen berücksichtigen – die Rede ist von Quantencomputern. Die Hoffnung: Sie sollen nicht nur deutlich effizienter rechnen, sondern die Grenze des Möglichen ein gutes Stück weit verschieben. Relevant ist das unter anderem bei der Entwicklung neuer Medikamente und Chemikalien, bei der mathematischen Optimierung in Logistik und Produktion, bei Berechnungen von Differentialgleichungen z.B. in der Strömungsmechanik sowie beim maschinellen Lernen. Die wirtschaftliche Wertschöpfung dürfte enorm sein. Eine Studie der Boston Consulting Gruppe erwartet, dass Quantencomputer in den nächsten 15 bis 30 Jahren in der Medikamentenentwicklung eine wirtschaftliche Wertschöpfung von bis zu 80 Mrd. US-Dollar nach sich ziehen, im Logistikbereich sogar von 100 Mrd. US-Dollar.
Grundlagen des Quantencomputings
Doch was unterscheidet das Quantencomputing eigentlich von klassischen Rechnern? Während die Berechnungen bei einem klassischen Computer auf Bits basieren, welche die Werte 0 oder 1 annehmen können, so fußt ein Quantencomputer auf Qubits – der Überlagerung beider quantenmechanischer Zustände |0⟩ und ∣1⟩ zugleich. Auch die Rechenoperationen laufen somit gänzlich anders. Schließlich beruht die Stärke der Quantenrechner auf quantenmechanischen Effekten, genauer gesagt der Überlagerung von Zuständen, der Verschränkung von Zuständen und der Interferenz. »Die Interferenz erlaubt es, Zustände zu verstärken oder abzuschwächen, wie dies auch von klassischen Wellen bekannt ist«, schreibt Jeanette Miriam Lorenz, Abteilungsleiterin Quantencomputing am Fraunhofer IKS im Buch »Künstliche Intelligenz und Wir: Stand, Nutzung und Herausforderungen der KI«. Die Überlagerung, auch Superposition genannt, ermöglicht es wiederum, Berechnungen des Quantencomputers gleichzeitig auf mehrere Zustände anzuwenden, die Berechnungen werden somit auf natürliche Weise parallelisiert.
Weitere Vorteile, die der Quantencomputer bietet: Die Kalkulationen sind weniger komplex und damit wahrscheinlich energieeffizienter – äußerst interessant also für High Performance Computing, das mit einem großen Energieverbrauch verbunden ist. Auch steht zu erwarten, dass die Generalisierung besser und die Berechnungskapazität im Algorithmus höher ist und sich Datenpunkte besser separieren lassen. Doch: All diese Vorteile sind derzeit (noch) eher theoretischer Natur – verlangen sie doch einen perfekten Quantencomputer ohne jegliche Fehler und Störeffekte.
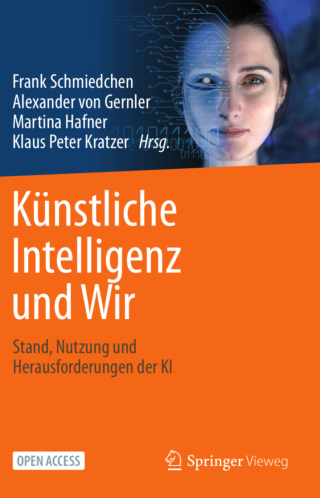
Dieser Artikel basiert auf dem Beitrag von PD Dr. habil. Jeanette Miriam Lorenz, Abteilungsleiterin am Fraunhofer IKS, im Buch »Künstliche Intelligenz und Wir. Stand, Nutzung und Herausforderungen der KI«. Herausgeber sind Frank Schmiedchen, Alexander von Gernler, Martina Hafner und Klaus Peter Kratzer.
Das Buch steht kostenlos zum Download zur Verfügung unter https://link.springer.com/book/9783662715666.
Wie kann nun ein Quantencomputer technisch realisiert werden? Dafür gibt es unterschiedliche Technologien. Zum einen lassen sich die benötigten zwei quantenmechanischen Zustände über atomare Zustände von einzelnen Atomen oder Ionen realisieren, beispielsweise über den Grundzustand und einen angeregten Zustand. Zum anderen eignen sich supraleitende Schwingkreise, die einen Oszillator mit verschiedenen Zuständen erzeugen. Verschiedene Hersteller bieten bereits entsprechende Quantencomputer an. Doch sind die Probleme damit keineswegs aus dem Weg geräumt: Es ist nach wie vor schwierig, die quantenmechanischen Systeme ausreichend von der Umgebung abzuschirmen – bereits winzige Störungen reichen aus, um die quantenmechanischen Eigenschaften zu zerstören. Etwa die kosmische Strahlung: Trifft sie einen Quantencomputer-Chip, kann dies Ladungslawinen auslösen, die dem Chip im schlimmsten Fall den Garaus bereiten können. Auch umfassen die derzeit erhältlichen Quantencomputer nur wenige Qubits, Supercomputer kommen bereits bei der Simulation von Systemen mit etwa 40 Qubits an ihr Limit. Das heißt: Die derzeitigen Quantencomputer können nur recht kleine Berechnungen durchführen – für eine industrielle Anwendung eignen sie sich aktuell noch nicht.
Quantengestützte KI
Langfristig jedoch ist das Quantencomputing vielversprechend. Beispielsweise im Bereich der Medizin, genauer gesagt beim Einsatz von KI-Algorithmen zur Diagnose- und Entscheidungsunterstützung. Bereits heute setzen Ärztinnen und Ärzte KI ein, um Knochenbrüche oder Tumore in MRT- und CT-Bildern aufzuspüren. Erschwert wird dies durch die geringe Menge an verfügbaren Trainingsdaten – oft liegen lediglich 100 oder 1000 Bilder vor, um die KI anzulernen. Gleichzeitig ist das geforderte Sicherheitslevel enorm hoch, schließlich dürfen die Entscheidungen den Patienten keinerlei Schaden zufügen. Quantengestützte KI könnte diese Lücke langfristig schließen: Es steht zu erwarten, dass die eingesetzten Algorithmen auch mit weniger Trainingsdaten zu einem guten Ergebnis kommen. Allerdings werden auch die klassischen Algorithmen stetig besser: Klassische Algorithmen und Quantenalgorithmen liefern sich also ein Wettrennen. Wer liefert die bessere Performance?
Quantenneuronale Netze
Die zweite Säule des quanten-maschinellen Lernens liegt im Bereich der quantenneuronalen Netze. Diese haben wenig Ähnlichkeit mit klassischen neuronalen Netzen: Während klassische neuronale Netze abwechselnd aus linearen und nichtlinearen Abfolgen bestehen, basieren die quantenneuronalen Netze auf linearen Transformationen. Ob Nichtlinearitäten für quantenneuronale Netze notwendig sind oder ob sie sogar schaden, wird derzeit noch erforscht. Klar ist jedoch: Quantenneuronale Netze lassen sich gut mit klassischen neuronalen Netzen kombinieren.
Auch ist derzeit noch nicht bekannt, wie viel Verschränkung notwendig ist und wie die Daten beschaffen sein müssen, damit quantenneuronale Netze ihren Vorteil ausspielen können. Wie lassen sich quantenneuronale Netze auf Quantenrechnern trainieren? Hier sind ebenfalls noch viele Fragen offen. Klassische Verfahren eignen sich für das Training nur mäßig, zumindest lassen sie sich nicht eins zu eins einsetzen: Das Trainieren ist in der Quantenwelt deutlich komplizierter. Zudem kann Rauschen das Training zusätzlich erschweren.
Sind Quantencomputer Big-Data-Maschinen?
Quantencomputer rechnen zahlreiche Rechenoperationen parallel. Sind sie damit also prädestiniert dafür, den stets wachsenden Datenmengen der digitalisierten Welt Herr zu werden? Sind sie – anders gefragt – also Big-Data-Maschinen? Das Nadelöhr liegt in den Quantenspeichern, QRAM genannt: Sie konnten bisher praktisch noch nicht realisiert werden. Doch ist die Fähigkeit, große Mengen an Daten zu speichern, elementar für die Verarbeitung großer Datenmengen. Dazu kommt: Auf aktuellen Quantencomputern lassen sich nur sehr kleine Probleme berechnen, bei größeren Herausforderungen wird das Ergebnis durch verschiedene Störeffekte wie die Quantendekohärenz komplett zunichte gemacht. »Aus diesen beiden genannten Gründen sind aktuelle Quantencomputer nicht als Big-Data-Maschinen einsetzbar; auch ist die Perspektive hier ungewiss«, schreibt Lorenz.
Erste Erfolge zeichnen sich ab
Derzeit sind die verfügbaren Quantencomputer noch nicht groß und zuverlässig genug, um bei industriell relevanten Fragestellungen einen Mehrwert gegenüber klassischen Rechnern zu erreichen. Jedoch schreitet die Entwicklung der Quantencomputing-Hardware stetig voran. So konnte beispielsweise IBM für einen spezifischen Algorithmus bereits erfolgreich Experimente durchführen, die nicht mehr auf klassischem Wege zu berechnen waren. Sie nutzten dafür einen supraleitenden Quantencomputing-Chip mit 127 Qubits. Durch das Zusammenspiel von Software, Algorithmik und Hardware können Quantencomputer also bereits jetzt in Bereiche gelangen, in denen sie mit klassischen Algorithmen mithalten.


